Dein Warenkorb ist gerade leer!
Jay Rosenberg
Philosophieren – Ein Handbuch für Anfänger. Textgrundlage: Jay F. Rosenberg: Philosophieren – Ein Handbuch für Anfänger. Klostermann, Frankfurt am Main 1989, S. 132-161. 8. Wie man einen philosophischen Streit entscheidet […]
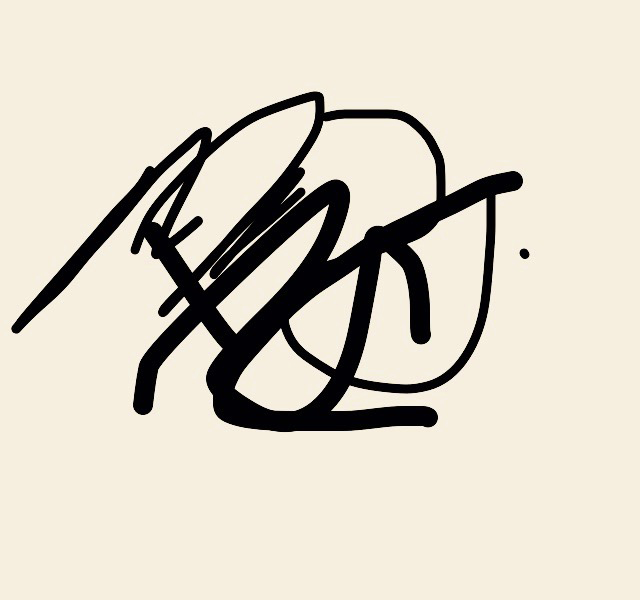
Philosophieren – Ein Handbuch für Anfänger.
Textgrundlage: Jay F. Rosenberg: Philosophieren – Ein Handbuch für Anfänger. Klostermann, Frankfurt am Main 1989, S. 132-161.
8. Wie man einen philosophischen Streit entscheidet
Jay Rosenberg leitet die zweite Zwischenbilanz mit der nochmaligen Betonung der Wichtigkeit der kritischen Prüfung einer Ansicht ein, mit der Begründung sie sei die fundamentale Form schlechthin, die jede philosophische Unternehmung bestehen müsse. Der ultimative Maßstab für die Akzeptanz einer These sei die Frage ob sie einer kritischen Prüfung, die analog zu der zu beurteilenden philosophiscstück einer Kritik bilde die interne Kohärenz, die vom expliziten Selbstwiderspruch bis zum subtileren Mißachten der Regeln des common sense, des vernünftigen Denkens untergraben werden könne. Aus den Regelverletzungen ergäbe sich konsequenterweise die philosophische Kritik, die in fünf Kategorien gemessen wurden: Äquivokation, petiio principii, infititen Regress, verlorenen Gegensatz und leere Behauptung. Bevor Rosenberg in Kapitel Acht eine weitere Form philosophischer Essays erläutert, rühmt er sich, neben einer klaren Klassifikation von Irr- und Musterwegen im vorigen Kapitel doch ein paar gute Tipps zur Regelung von Bedeutungsfragen innerhalb einer philosophischen Untersuchung gegeben zu haben.
Als zweiten Typ eines philosophischen Essay führt Rosenberg den urteilenden bzw. richtenden Essay vor, der die simpelste Form zur Prüfung einer kritischen Ansicht sei und zweckmäßig in sechs Teile gegliedert werden möge, anhand derer der Autor zu einer Positionierung der Stärken und Schwächen der Kontrahenten befähigt werden könne. Diese seien wie folgt gegliedert, wobei natürlich die Vorgehensweise modifiziert werden könne:
1. Formulierung des Problems
2. Darstellung der 1. Position
3. Bewertung der 1. Position
4. Darstellung der 2. Position
5. Bewertung der 2. Position
6. Entscheidung
1. Als Hindernis bei der Herauskristallisierung des Problems sieht Rosenberg die hohen Anforderung an die Interpretationsfähigkeiten des Autors eines kritischen Essays. Eventuelle Überschneidungen der Meinungen könnten auf der einen
Mit der Formulierung des Problems als Frage, auf die die Kontrahenten unterschiedliche Antworten geben würden, stelle man dem Leser einen Wegweiser zur Verfügung, der eine große Hilfe sein könne, die kontroversen Texte zu ordnen. Das Kernproblem laut Rosenberg sei die Tatsache, daß die Argumentationen in der dialektischen Diskussion sich nicht zwangsläufig auf die Hauptthesen bezögen sondern die Auseinandersetzungen sich fern dieser Thesen auf die sie stützenden Prämissen beriefen.
2. und 4. Nach der Formulierung des Problems sollten sich die zwei Positionen an dieser Fragestellung dermaßen orientieren, daß eine Einsicht in die jeweilige Argumentation der beiden Parteien, bezogen auf das formulierte Problem, möglich wäre. Die Verbindung zwischen dem philosophischen Problem und der argumentierenden Thesen sei in de
n meisten Fällen rückwärts zu rekonstruieren und zusätzlich dadurch erschwert, daß die unterschiedlichen Thesen miteinander in Korrelation gebracht werden müssen.
3. und 5. Die Bewertung der unterschiedlichen Positionen bilde den kompliziertesten Teil des Unterfangens, da sowohl die Relevanz der Argumentationen im hypothetischen Falle zu berücksichtigen sei – also was die jeweilige Seite auf die rivalisierenden Thesen zu entgegnen hätte – als auch eine wohlwollende Darstellung der tatsächlich formulierten Thesen vom den Standpunkten des anderen Textes, so daß man einschätzen könne was zumindest eine der beiden Parteien als Gegenargumente parat hätte. Als Voraussetzung dieser Vorgehensweise sei laut Rosenberg das Lesen der Texte mit der Ambition ihnen ihre maximale Stärke zuzugestehen.
6. Bei der finalen Entscheidung wäre eine absolute Stellungnahme meistens unmöglich, vielmehr müssˇe man als Autor darauf bedacht sein ein Amalgam aus den verschiedenen Einsichten der Kontrahenten, womöglich ergänzt durch eigene Thesen, zu formulieren. Unterschiedliche Lesarten der Texte, unterschiedliche Bedeutungen eines benützten Terminus, verschiedene Interpretationen eines Argumentes seitens der Kontrahenten etc. anzugeben, kann nützlich sein, sich manch begrifflicher Konfusionen zu entziehen und Irrwege in der Argumentation zu verdeutlichen.
Im Fazit sei laut Rosenberg der gut strukturierte kritische Essay eine größere Leistung als das Prüfen einer einzigen Ansicht, da nicht nur die Technik der Dialektik beherrscht werden müsse, sondern auch das Formulieren einer eventuell nicht mit der eigenen Position übereinstimmenden philosophischen Argumentation zu meistern sei. Dazu bedürfe es ein großes Maß an Auslegung und philosophischer Phantasie, die ein weitgehendes Verstehen der Positionen erfordert und nicht nur negativistisch eine einzelne argumentative Position ruinieren will.
9. Wie man ein Pro
Als dritten Typus eines philosophischen Essays, der ebensosehr wie der richtende Essay problemorientiert sei und dazu noch verstärkt Selbständigkeit und kreative Kompetenzen des Autors abverlange, sei einer der die Lösung eines Problems intendiert und ebenso in sechs Teile gegliedert werden könne.
1. Formulierung und Analyse des Problems
2. Entwicklung von Kriterien für eine adäquate Lösung
(3. Untersuchung möglicher, aber inadäquater Lösungen)
4. Entfaltung der vorgeschlagenen Lösung
5. Prüfung der Adäquatheit der vorgeschlagenen Lösung
(6. Antworten auf erwartbare Kritik)
Anhand dieses Leifadens soll einer konkreten epistemologischen Problemstellung nachgespürt werden:
Astronomen sagen, Licht brauche vier Jahre, um von nächstgelegenen Stern bis zu uns zu gelangen. Doch in diesen vier Jahren könnte der Stern aufgehört haben zu existieren, und wir können nichts sehen, was nicht existiert. Sehen wir also jemals einen Sterfln?
Mit großem Nachdruck erinnert Rosenfeld an die mögliche Befreiung und die Freude des Philosophierens und zielt auf die, ihm als sicher geltende, Lösung dieses Problems ab, nicht ohne jedoch vorher nochmals auf die enorm wichtigen Implikationen dieses Problems zu verweisen, die einem Anfänger unergründlich seien und als ein Problem des Typs „Wen kümmert‘s?“ deklassiert werden würden. Anschließend reduziert Rosenberg das Potenzial seiner pädagogischen Ambitionen mit dem Argument, der Ursprung des Wunsches nach Wissen müsse individuell aus jedem selbst entspringen und sei nicht vermittelbar, ein wenig um anschließend die Problemstellung genauer zu analysieren. Diese sei nicht die Frage, ob man jemals einen Stern sehe, sondern die unterstellte Behauptung man meine manchmal einen Stern zu sehen, wenn man tatsächlich keinen sieht. Mit elementarsten Kentnissen physiologisch-kognitiver Reaktionen ließe sich eine Argumentationskette konstruieren, die davon ausgeht erst etwas zu sflehen, wenn Licht auf entsprechende Sehorgane wirkt. Unter diesen Umständen könne es möglich sein, daß ein Stern zum Zeitpunkt der Lichtrezeption nicht mehr existiere und die Konsequenz eine paradoxe Schlußfolgerung der Art „Wir sehen den Stern nicht, weil wir nicht sehen können was nicht existiert.“ wäre. Nach der Klarstellung des Unterschieds zwischen „Etwas wirklich zu sehen“ und derjenigen „Etwas bloß zu sehen meinen“ weist Rosenberg in seiner Analyse darauf hin, daß die Existenz einer Sache nicht von der Empfindung derer durch Wahrnehmungsorgane abgeleitet werden könne. „Wenn das, was wir zu sehen meinen, nicht existiert, sehen wir es tatsächlich nicht. Wir glauben nur, es zu sehen.“ Die Situation des Sehen-Glaubens ließe sich unter Zuhilfenahme rudimentären astronomischen Wissens und des common sense in zwei Fälle unterteilen. Erstens: Der gesehene Stern ist tatsächlich an dem, ihm anhand der Seherfahrung, zuweisbaren Platz. Zweitens: Der gesehene Stern ist zum Zeitpunktˇ des Sehens nicht mehr existent. Im Kontrast zur „echten“ Seherfahrung im ersten Fall, ließe sich im zweiten Fall kein Kriterium finden, das eine Klärung des Sehzweifels ermöglichen würde. Es wäre denkbar, allen Seherfahrungen aufgrund der identischen Reaktion der Netzhaut die Gewissheit abzusprechen und sie unter den zweiten Fall zu fassen. Um der Widersprüchlichkeit des common sense mit mancher wissenschaftlichen Hypothese entgegenzuwirken, wird der Vorgang der Seherfahrung von dem Objekt des Sternes auf das Objekt des ausgesandten Lichtes verlagert. Unter dieser wissenschaftlich fundierten Annahme wäre die Aufassung des common sense jedoch vernachlässigt, man sehe tatsächlich Dinge ansttatt deren Lichtreflektionen. Der Vorgang des Sehens sei bedingt durch Licht, die Grundlage der Reflektionen seien aber dennoch reale Gegenstände. „Das Licht ist das Mittel optischer Wahrnehmung, nicht deren Gegenstand.“ Ebenso könnte man einen qualitativen Unterschied zwischen einer geglaubten Wahrnehmung machen (z.B. eineht („Wir können nichts sehen, was zum Zeitpunkt, in dem wir es zu sehen meinen, nicht existiert.“) und die zweite Lesart eine radikalere Aussage der Form „Wir können nichts sehen, was niemals existiert.“ macht. Aufgrund der zweiten Aussage kann man nun widerspruchsfrei behaupten, in beiden Fällen des Wahrnehmens tatsächlich einen Stern gesehen zu haben. Der Einwand, es sei unmöglich zu entscheiden welcher Fall von Wahrnehmen vorläge, könne entgegnet werden, die Entscheidung sei tatsächlich immer individuell, quasi a posteriori, zu treffen, etwa
(A) Wir können nicht aufgrund der Untersuchung einer einzelnen Erfahrung behaupten, daß keine Haluzination vorliegt.
Also könnte jede Erfahrung eine Halluzination sein.
(B) Jede Erfahrung könnte eine Halluzination sein.
Also könnte es sein, daß alle Erfahrungen Halluzinationen sind.
Im Anschluß and die Vorgehensweise zur Verteidigung einer philosophischen These, die unter anderem die Vorwegnahme von Gegenargumenten oder die erhöhten literarischen Anforderungen nennt, erwägt Rosenberg sechs Möglichkeiten einen Philosophen zu lesen.
11. Die Notwendigkeit philosophische Werke auf unterschiedliche We
1. Als erste Möglichkeit nennt dabei Rosenberg die Vorgehensweise, einen Philosophen auf seine Resultate hin zu untersuchen und zu beleuchten was den Inhalt des Denkens ausmacht, dieses zu Klassifizieren und gemäß Epochen, Schulen, Stile etc. zu ordnen.
2. Als nächsten Schrittt könne man einen Philosophen auf seine Argumente hin lesen, um die den Thesen zugrundeliegende Struktur herauszukristallisieren. In diesem Fall kommt der Frage nach der Richtung des Denkens die Frage nach dem Warum hinzu. Verknüpfungen verschiedener Konklusionen und die Konstellat
3. Die Positionierung eines philosophischen Argumentes innerhalb der historischen und sozialen Gefüge sowie die Auswirkungen neu definierter Termini sind Bestandteil der Interpretation eines Philosophen in seinem dialektischen Zusammenhang, dem Wie des Denkens.
4. Anhand der Resultate der Argumentationen, der benützten Argumente und dem Verstehen derer, könne man dazu übergehen einen Philosophen kritisch zu lesen. Hier müsse man wiederum hypothetische Antworten auf eventuelle Kritik formulieren können, sich auf einen Dialog mit den philosophischen Argumenten einlassen können und über oberflächliche philosophische Spitzfindigkeiten hinausgehen.
5. Man könne einen Text auch zielgerichtet auf die Entscheidung eines Problems hin lesen indem man die Argumentat
6. Abseits der vorherigen Methoden, positioniert Rosenberg die Möglichkeit einen Philosophen kreativ zu lesen. Die Probleme des philosophischen Textes hätten die Grenze zur eigenen Position transzendiert und die Fragestellungen subjektiviert.
Im Rückblick weist Rosenberg auf die Notwendigkeit von Schranken und Limitationen hin, die um sich derer bewußt zu machen, erst mittels des Denkens zu lösen sind. Auch sollte man sich der Möglichkeit bewußt sein, aufgrund des Privilegs der Sprache und Vernunft mit dieser menschlichen Lust nach Befreiung und Klarheit an ein Ziel kommen zu können.
Philosophieren – Ein Handbuch für Anfänger.
Textgrundlage: Jay F. Rosenberg: Philosophieren – Ein Handbuch für Anfänger. Klostermann, Frankfurt am Main 1989, S. 132-161.
8. Wie man einen philosophischen Streit entscheidet
Jay Rosenberg leitet die zweite Zwischenbilanz mit der nochmaligen Betonung der Wichtigkeit der kritischen Prüfung einer Ansicht ein, mit der Begründung sie sei die fundamentale Form schlechthin, die jede philosophische Unternehmung bestehen müsse. Der ultimative Maßstab für die Akzeptanz einer These sei die Frage ob sie einer kritischen Prüfung, die analog zu der zu beurteilenden philosophiscstück einer Kritik bilde die interne Kohärenz, die vom expliziten Selbstwiderspruch bis zum subtileren Mißachten der Regeln des common sense, des vernünftigen Denkens untergraben werden könne. Aus den Regelverletzungen ergäbe sich konsequenterweise die philosophische Kritik, die in fünf Kategorien gemessen wurden: Äquivokation, petiio principii, infititen Regress, verlorenen Gegensatz und leere Behauptung. Bevor Rosenberg in Kapitel Acht eine weitere Form philosophischer Essays erläutert, rühmt er sich, neben einer klaren Klassifikation von Irr- und Musterwegen im vorigen Kapitel doch ein paar gute Tipps zur Regelung von Bedeutungsfragen innerhalb einer philosophischen Untersuchung gegeben zu haben.
Als zweiten Typ eines philosophischen Essay führt Rosenberg den urteilenden bzw. richtenden Essay vor, der die simpelste Form zur Prüfung einer kritischen Ansicht sei und zweckmäßig in sechs Teile gegliedert werden möge, anhand derer der Autor zu einer Positionierung der Stärken und Schwächen der Kontrahenten befähigt werden könne. Diese seien wie folgt gegliedert, wobei natürlich die Vorgehensweise modifiziert werden könne:
1. Formulierung des Problems
2. Darstellung der 1. Position
3. Bewertung der 1. Position
4. Darstellung der 2. Position
5. Bewertung der 2. Position
6. Entscheidung
1. Als Hindernis bei der Herauskristallisierung des Problems sieht Rosenberg die hohen Anforderung an die Interpretationsfähigkeiten des Autors eines kritischen Essays. Eventuelle Überschneidungen der Meinungen könnten auf der einen
Mit der Formulierung des Problems als Frage, auf die die Kontrahenten unterschiedliche Antworten geben würden, stelle man dem Leser einen Wegweiser zur Verfügung, der eine große Hilfe sein könne, die kontroversen Texte zu ordnen. Das Kernproblem laut Rosenberg sei die Tatsache, daß die Argumentationen in der dialektischen Diskussion sich nicht zwangsläufig auf die Hauptthesen bezögen sondern die Auseinandersetzungen sich fern dieser Thesen auf die sie stützenden Prämissen beriefen.
2. und 4. Nach der Formulierung des Problems sollten sich die zwei Positionen an dieser Fragestellung dermaßen orientieren, daß eine Einsicht in die jeweilige Argumentation der beiden Parteien, bezogen auf das formulierte Problem, möglich wäre. Die Verbindung zwischen dem philosophischen Problem und der argumentierenden Thesen sei in de
n meisten Fällen rückwärts zu rekonstruieren und zusätzlich dadurch erschwert, daß die unterschiedlichen Thesen miteinander in Korrelation gebracht werden müssen.
3. und 5. Die Bewertung der unterschiedlichen Positionen bilde den kompliziertesten Teil des Unterfangens, da sowohl die Relevanz der Argumentationen im hypothetischen Falle zu berücksichtigen sei – also was die jeweilige Seite auf die rivalisierenden Thesen zu entgegnen hätte – als auch eine wohlwollende Darstellung der tatsächlich formulierten Thesen vom den Standpunkten des anderen Textes, so daß man einschätzen könne was zumindest eine der beiden Parteien als Gegenargumente parat hätte. Als Voraussetzung dieser Vorgehensweise sei laut Rosenberg das Lesen der Texte mit der Ambition ihnen ihre maximale Stärke zuzugestehen.
6. Bei der finalen Entscheidung wäre eine absolute Stellungnahme meistens unmöglich, vielmehr müssˇe man als Autor darauf bedacht sein ein Amalgam aus den verschiedenen Einsichten der Kontrahenten, womöglich ergänzt durch eigene Thesen, zu formulieren. Unterschiedliche Lesarten der Texte, unterschiedliche Bedeutungen eines benützten Terminus, verschiedene Interpretationen eines Argumentes seitens der Kontrahenten etc. anzugeben, kann nützlich sein, sich manch begrifflicher Konfusionen zu entziehen und Irrwege in der Argumentation zu verdeutlichen.
Im Fazit sei laut Rosenberg der gut strukturierte kritische Essay eine größere Leistung als das Prüfen einer einzigen Ansicht, da nicht nur die Technik der Dialektik beherrscht werden müsse, sondern auch das Formulieren einer eventuell nicht mit der eigenen Position übereinstimmenden philosophischen Argumentation zu meistern sei. Dazu bedürfe es ein großes Maß an Auslegung und philosophischer Phantasie, die ein weitgehendes Verstehen der Positionen erfordert und nicht nur negativistisch eine einzelne argumentative Position ruinieren will.
9. Wie man ein Pro
Als dritten Typus eines philosophischen Essays, der ebensosehr wie der richtende Essay problemorientiert sei und dazu noch verstärkt Selbständigkeit und kreative Kompetenzen des Autors abverlange, sei einer der die Lösung eines Problems intendiert und ebenso in sechs Teile gegliedert werden könne.
1. Formulierung und Analyse des Problems
2. Entwicklung von Kriterien für eine adäquate Lösung
(3. Untersuchung möglicher, aber inadäquater Lösungen)
4. Entfaltung der vorgeschlagenen Lösung
5. Prüfung der Adäquatheit der vorgeschlagenen Lösung
(6. Antworten auf erwartbare Kritik)
Anhand dieses Leifadens soll einer konkreten epistemologischen Problemstellung nachgespürt werden:
Astronomen sagen, Licht brauche vier Jahre, um von nächstgelegenen Stern bis zu uns zu gelangen. Doch in diesen vier Jahren könnte der Stern aufgehört haben zu existieren, und wir können nichts sehen, was nicht existiert. Sehen wir also jemals einen Sterfln?
Mit großem Nachdruck erinnert Rosenfeld an die mögliche Befreiung und die Freude des Philosophierens und zielt auf die, ihm als sicher geltende, Lösung dieses Problems ab, nicht ohne jedoch vorher nochmals auf die enorm wichtigen Implikationen dieses Problems zu verweisen, die einem Anfänger unergründlich seien und als ein Problem des Typs „Wen kümmert‘s?“ deklassiert werden würden. Anschließend reduziert Rosenberg das Potenzial seiner pädagogischen Ambitionen mit dem Argument, der Ursprung des Wunsches nach Wissen müsse individuell aus jedem selbst entspringen und sei nicht vermittelbar, ein wenig um anschließend die Problemstellung genauer zu analysieren. Diese sei nicht die Frage, ob man jemals einen Stern sehe, sondern die unterstellte Behauptung man meine manchmal einen Stern zu sehen, wenn man tatsächlich keinen sieht. Mit elementarsten Kentnissen physiologisch-kognitiver Reaktionen ließe sich eine Argumentationskette konstruieren, die davon ausgeht erst etwas zu sflehen, wenn Licht auf entsprechende Sehorgane wirkt. Unter diesen Umständen könne es möglich sein, daß ein Stern zum Zeitpunkt der Lichtrezeption nicht mehr existiere und die Konsequenz eine paradoxe Schlußfolgerung der Art „Wir sehen den Stern nicht, weil wir nicht sehen können was nicht existiert.“ wäre. Nach der Klarstellung des Unterschieds zwischen „Etwas wirklich zu sehen“ und derjenigen „Etwas bloß zu sehen meinen“ weist Rosenberg in seiner Analyse darauf hin, daß die Existenz einer Sache nicht von der Empfindung derer durch Wahrnehmungsorgane abgeleitet werden könne. „Wenn das, was wir zu sehen meinen, nicht existiert, sehen wir es tatsächlich nicht. Wir glauben nur, es zu sehen.“ Die Situation des Sehen-Glaubens ließe sich unter Zuhilfenahme rudimentären astronomischen Wissens und des common sense in zwei Fälle unterteilen. Erstens: Der gesehene Stern ist tatsächlich an dem, ihm anhand der Seherfahrung, zuweisbaren Platz. Zweitens: Der gesehene Stern ist zum Zeitpunktˇ des Sehens nicht mehr existent. Im Kontrast zur „echten“ Seherfahrung im ersten Fall, ließe sich im zweiten Fall kein Kriterium finden, das eine Klärung des Sehzweifels ermöglichen würde. Es wäre denkbar, allen Seherfahrungen aufgrund der identischen Reaktion der Netzhaut die Gewissheit abzusprechen und sie unter den zweiten Fall zu fassen. Um der Widersprüchlichkeit des common sense mit mancher wissenschaftlichen Hypothese entgegenzuwirken, wird der Vorgang der Seherfahrung von dem Objekt des Sternes auf das Objekt des ausgesandten Lichtes verlagert. Unter dieser wissenschaftlich fundierten Annahme wäre die Aufassung des common sense jedoch vernachlässigt, man sehe tatsächlich Dinge ansttatt deren Lichtreflektionen. Der Vorgang des Sehens sei bedingt durch Licht, die Grundlage der Reflektionen seien aber dennoch reale Gegenstände. „Das Licht ist das Mittel optischer Wahrnehmung, nicht deren Gegenstand.“ Ebenso könnte man einen qualitativen Unterschied zwischen einer geglaubten Wahrnehmung machen (z.B. eineht („Wir können nichts sehen, was zum Zeitpunkt, in dem wir es zu sehen meinen, nicht existiert.“) und die zweite Lesart eine radikalere Aussage der Form „Wir können nichts sehen, was niemals existiert.“ macht. Aufgrund der zweiten Aussage kann man nun widerspruchsfrei behaupten, in beiden Fällen des Wahrnehmens tatsächlich einen Stern gesehen zu haben. Der Einwand, es sei unmöglich zu entscheiden welcher Fall von Wahrnehmen vorläge, könne entgegnet werden, die Entscheidung sei tatsächlich immer individuell, quasi a posteriori, zu treffen, etwa
(A) Wir können nicht aufgrund der Untersuchung einer einzelnen Erfahrung behaupten, daß keine Haluzination vorliegt.
Also könnte jede Erfahrung eine Halluzination sein.
(B) Jede Erfahrung könnte eine Halluzination sein.
Also könnte es sein, daß alle Erfahrungen Halluzinationen sind.
Im Anschluß and die Vorgehensweise zur Verteidigung einer philosophischen These, die unter anderem die Vorwegnahme von Gegenargumenten oder die erhöhten literarischen Anforderungen nennt, erwägt Rosenberg sechs Möglichkeiten einen Philosophen zu lesen.
11. Die Notwendigkeit philosophische Werke auf unterschiedliche We
1. Als erste Möglichkeit nennt dabei Rosenberg die Vorgehensweise, einen Philosophen auf seine Resultate hin zu untersuchen und zu beleuchten was den Inhalt des Denkens ausmacht, dieses zu Klassifizieren und gemäß Epochen, Schulen, Stile etc. zu ordnen.
2. Als nächsten Schrittt könne man einen Philosophen auf seine Argumente hin lesen, um die den Thesen zugrundeliegende Struktur herauszukristallisieren. In diesem Fall kommt der Frage nach der Richtung des Denkens die Frage nach dem Warum hinzu. Verknüpfungen verschiedener Konklusionen und die Konstellat
3. Die Positionierung eines philosophischen Argumentes innerhalb der historischen und sozialen Gefüge sowie die Auswirkungen neu definierter Termini sind Bestandteil der Interpretation eines Philosophen in seinem dialektischen Zusammenhang, dem Wie des Denkens.
4. Anhand der Resultate der Argumentationen, der benützten Argumente und dem Verstehen derer, könne man dazu übergehen einen Philosophen kritisch zu lesen. Hier müsse man wiederum hypothetische Antworten auf eventuelle Kritik formulieren können, sich auf einen Dialog mit den philosophischen Argumenten einlassen können und über oberflächliche philosophische Spitzfindigkeiten hinausgehen.
5. Man könne einen Text auch zielgerichtet auf die Entscheidung eines Problems hin lesen indem man die Argumentat
6. Abseits der vorherigen Methoden, positioniert Rosenberg die Möglichkeit einen Philosophen kreativ zu lesen. Die Probleme des philosophischen Textes hätten die Grenze zur eigenen Position transzendiert und die Fragestellungen subjektiviert.
Im Rückblick weist Rosenberg auf die Notwendigkeit von Schranken und Limitationen hin, die um sich derer bewußt zu machen, erst mittels des Denkens zu lösen sind. Auch sollte man sich der Möglichkeit bewußt sein, aufgrund des Privilegs der Sprache und Vernunft mit dieser menschlichen Lust nach Befreiung und Klarheit an ein Ziel kommen zu können.
Schreibe einen Kommentar